Freiheit in der Arbeitswelt: Kein Entweder-Oder
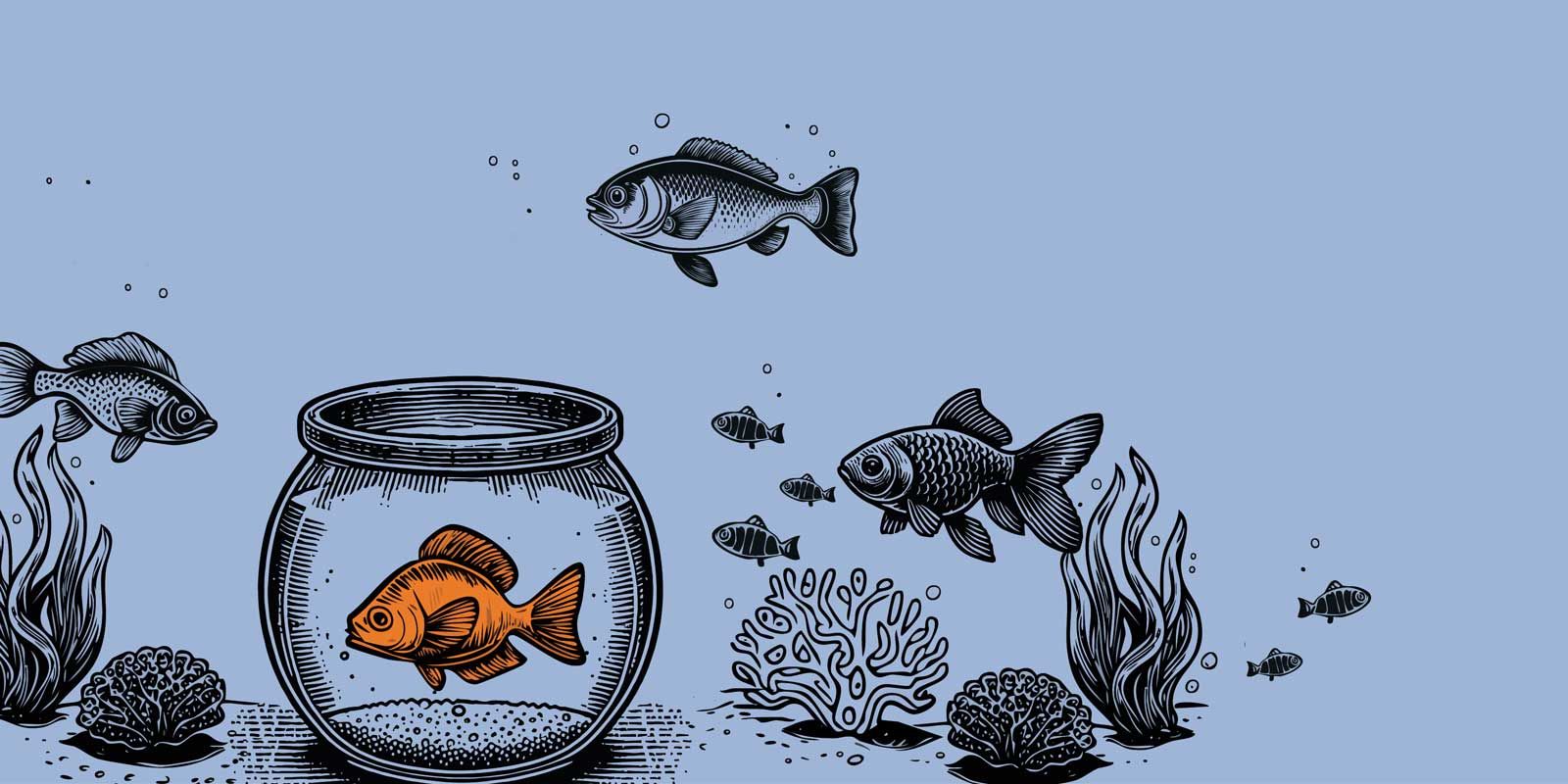
In einer Zeit, in der Homeoffice, Work-Life-Balance und hybride Arbeitsmodelle zum Alltag gehören, sprechen wir viel über Freiheit. Doch was heisst das konkret für Mitarbeitende, Führungskräfte, Organisationen? Und wie können wir Freiheit so gestalten, dass sie für alle Seiten tragfähig bleibt?
«Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt» – dieser Satz von Immanuel Kant begleitet mich schon lange. Er gilt nicht nur im privaten Zusammenleben, sondern beschreibt treffend das Spannungsfeld, in dem sich auch unsere moderne Arbeitswelt bewegt.
Freiheit heute – ein vielschichtiger Begriff
Freiheit ist nicht nur ein politisches Ideal. Sie ist Ausdruck unseres menschlichen Bedürfnisses nach Selbstbestimmung, Gestaltungsspielraum und Teilhabe. Aber sie ist nie absolut – sie ist eingebettet in wirtschaftliche, kulturelle und soziale Rahmenbedingungen. Besonders in der Arbeitswelt treffen Autonomie und Verantwortung täglich aufeinander.
Selbstbestimmung auch im Job
Im HR-Bereich erleben wir zunehmend, wie essenziell Selbstbestimmung für Motivation und Leistung ist. Besonders im Hinblick auf den Generationenwandel wird klar: Menschen, die mitgestalten dürfen, sind engagierter, kreativer und langfristig gebundener. Flexible Modelle wie Vertrauensarbeitszeit, Homeoffice oder Jobsharing bieten hierfür eine gute Basis.
Die sogenannte Selbstbestimmungstheorie bestätigt das wissenschaftlich: Wer Entscheidungen über sein Arbeiten mittragen kann, empfindet mehr Zufriedenheit. Aber – und das ist mir wichtig zu betonen – Freiheit braucht auch Strukturen, die sie halten.
Verantwortung als Gegengewicht zur Freiheit
Freiheit in Unternehmen endet dort, wo Zusammenarbeit beginnt. Wer Entscheidungsfreiheit einfordert, muss auch Verantwortung übernehmen – gegenüber dem Team, der Kundschaft und den Unternehmenszielen. Führungskräfte nehmen hier eine Schlüsselrolle ein: Sie sollen Freiraum ermöglichen, aber auch Sicherheit und Orientierung bieten. Das braucht Vertrauen, Kommunikation auf Augenhöhe und ein klares Rollenverständnis.
«Wer Entscheidungsfreiheit einfordert, muss auch Verantwortung übernehmen.»
Barrieren erkennen und abbauen
Nicht jeder Mensch erlebt dieselben Freiheitsgrade. Körperliche Einschränkungen, mangelnde Barrierefreiheit, sprachliche Hürden oder psychische Belastungen können die Teilhabe am Arbeitsalltag massiv erschweren.
Für mich ist klar: HR ist hier in der Pflicht. Durch inklusive Prozesse, barrierefreie Tools und gezielte Sensibilisierung können wir echte Chancengleichheit schaffen – und damit mehr individuelle Freiheit ermöglichen.
Warum weniger manchmal mehr ist
Freiheit bedeutet nicht grenzenlose Wahlmöglichkeiten. Gerade in herausfordernden Zeiten (wie der Corona-Pandemie) waren klare Regeln und verlässliche Kommunikation entscheidend. Auch ethische oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen setzen Grenzen, und das ist gut so.
Der Philosoph Jean-Pierre Wils formuliert es treffend: Freiheit kann auch bedeuten, bewusst auf etwas zu verzichten. Zugunsten von Nachhaltigkeit, Gemeinwohl und Sinn. Für mich heisst das: Weniger Kontrolle, mehr Vertrauen. Weniger Leistungsdruck, mehr Raum für Entwicklung und Kooperation.
Mein Blick aus der HR-Praxis
Als HR-Expertin und Unternehmerin erlebe ich Freiheit täglich in unterschiedlichen Facetten. Für mich persönlich bedeutet sie, meine Arbeitsweise selbst gestalten zu können: flexibel, effizient und sinnvoll. Gleichzeitig stosse ich immer wieder an Grenzen: starre Prozesse, knappe Ressourcen, Zielkonflikte zwischen Unternehmensinteressen und individuellen Bedürfnissen.
Ich sehe, wie mein Unternehmen Freiheit fördert, etwa durch flexible Arbeitsmodelle, Weiterbildungsmöglichkeiten oder eine offene Feedbackkultur. Aber ich sehe auch, wo wir besser werden können: bei der Barrierefreiheit digitaler Anwendungen, bei der Inklusion neurodivergenter Kolleg:innen, bei der gezielten Förderung von benachteiligten Menschen.
Freiheit als gemeinsamer Gestaltungsprozess
Freiheit ist kein statischer Zustand, sondern ein dynamischer Prozess. In der HR-Arbeit geht es darum, Räume zu schaffen, Rahmen zu setzen und Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Es ist nicht das Ziel, maximale Freiheit zu gewähren, sondern sinnvolle. Heisst: Faire, klare und belastbare Freiheiten zu gestalten.
«Freiheit zeigt sich nicht in der Abwesenheit von Regeln, sondern in der Fähigkeit, selbstbestimmt innerhalb sinnvoller Strukturen zu handeln.»
Jenseits der Komfortzone denken
In meiner Tätigkeit erlebe ich oft, wie stark viele Menschen an der vermeintlichen Sicherheit eines festen Arbeitsverhältnisses festhalten. Mit regelmässigem Einkommen, Urlaubstagen, Hierarchien. Das ist verständlich. Aber ist es wirklich Sicherheit?
Krisen, Kündigungen oder gesundheitliche Abhängigkeiten zeigen: Auch Angestellte tragen Risiken, nur fühlen sie sich oft sicherer, weil diese Risiken weniger sichtbar sind. Selbstständigkeit hingegen gilt oft als riskant, birgt aber auch enorme Chancen für mehr Selbstbestimmung und Stabilität.
Ich will jetzt Selbstständigkeit nicht idealisieren oder als Patentrezept präsentieren. Aber ich will zum Nachdenken anregen: über unsere Komfortzonen, über die echten Quellen von Sicherheit. Und über den Mut, berufliche Freiheit aktiv zu gestalten.
Freiheit in der Arbeitswelt ist kein Entweder-Oder. Sie ist ein Balanceakt zwischen Vertrauen und Verantwortung, zwischen Struktur und Spielraum. Und sie ist ein kontinuierlicher Lernprozess für Mitarbeitende, Führungskräfte und Organisationen.
Wir alle sind gefordert, diesen Raum gemeinsam zu gestalten.
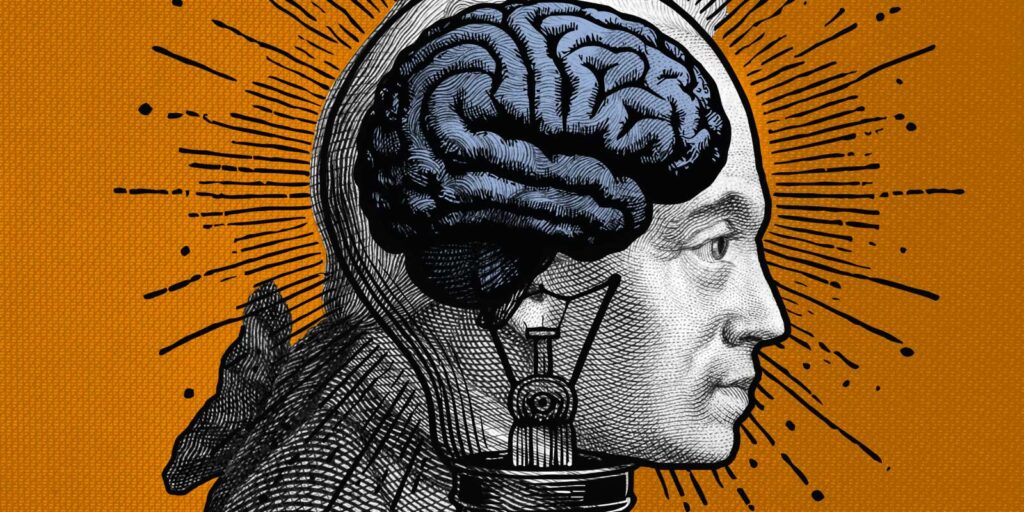
Podcast-Tipp:
301 Jahre Kant – Ist Aufklärung heute wichtiger denn je?
Vor 301 Jahren wurde der grösste Revolutionär des menschlichen Geistes geboren. Sein Name: Immanuel Kant. Seine Mission: Aufklärung. Seine Wirkung: weltverändernd. Der Philosoph Marcus Willaschek erklärt die Wichtigkeit Kants für die Krisenzeit. Ist die Würde des Menschen unantastbar? Was bedeutet es, wirklich selbstbestimmt zu handeln? Und leben wir eigentlich in einem Zeitalter der Aufklärung? Kernfragen des Werks von Immanuel Kant (1724-1804).









