Viele Kunden sind noch nicht so weit
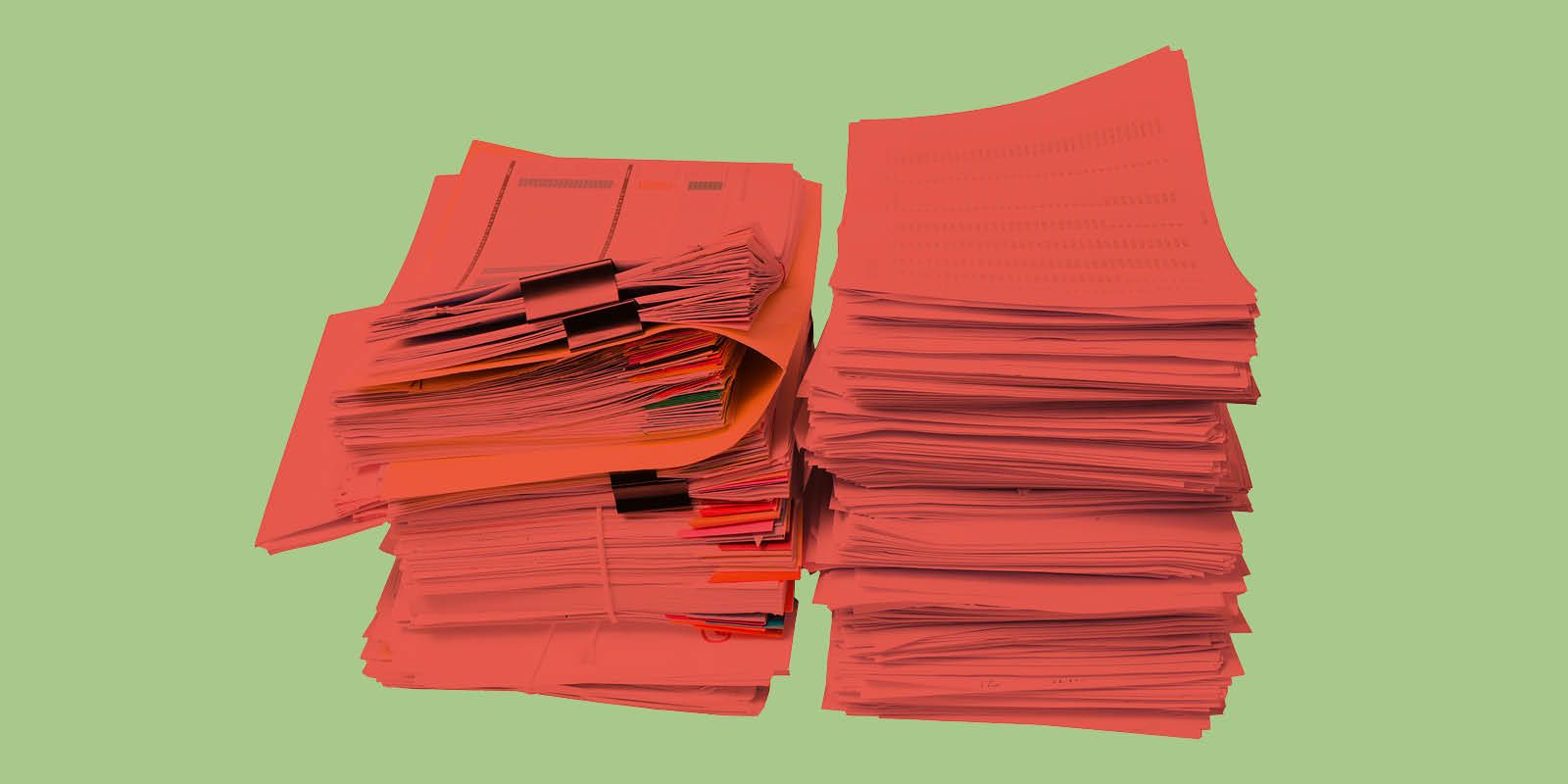
Digitalisierung – bei vielen Menschen löst dieses Wort immer noch gemischte Gefühle aus: von Begeisterung und Euphorie bis zu Ablehnung, ja Verzweiflung. Nicht zuletzt, weil es schwierig vorherzusagen ist, wie die Technologien in Zukunft aussehen werden. In den letzten Jahren war eine der Schwierigkeiten, Daten und Belege in digitaler Form zu erhalten. Viele Kunden sind mangels Wissen oder wegen veralteter Buchhaltungssysteme nicht in der Lage, die Saldobilanzen, Journale und Kontendetails elektronisch bereitzustellen.
An der EXPERTsuisse Treuhandtagung 2021 wurde erstmals das Konzept der 9-Felder-Matrix vorgestellt. Der Konzeptrahmen beruht auf dem vertikalen «Auslagerungsgrad der Finanzprozesse» und dem horizontalen «Digitalisierungsgrad der Finanzprozesse». Jede dieser Dimensionen wird in drei Ausprägungen gegliedert, wodurch neun Treuhandmodelle entstehen. Während links unten das traditionelle und nur punktuell externe Modell steht, ist rechts oben das voll digitale und ausgelagerte Modell. Dazwischen liegen sieben weitere Modelle.
Unsere Kunden bewegen sich mehrheitlich im Bereich «traditionell». Einige sind partiell und erst wenige vollständig digitalisiert, automatisierte Prozesse finden sich kaum. Belege sind nicht gescannt und können dem Wirtschaftsprüfungsteam somit auch nicht in elektronischer Form übergeben werden.
Papierlos? Lange eine Illusion
Die Digitalisierung bei Solidis hat im Jahr 1989 mit der Anschaffung eines Serversystems, von acht Laptops und zwei Druckern von IBM für insgesamt rund CHF 150’000 begonnen. Anstatt die Revisions- und Erläuterungsberichte aus dem Vorjahr auf Papier zu überschreiben und durch das Sekretariat im Schreibsystem erfassen zu lassen, wurden die Berichte in Excel und Word noch während der Revision überarbeitet. Die Buchhaltungen wurden nicht mehr mit dem Buchungsautomaten, sondern erstmals mit einer Software verarbeitet. Auch bei den Steuern wagten wir den Schritt zu einer Software, mit der wir mehr schlecht als recht die Daten erfassten. In allen drei Bereichen änderte sich aber an der Aufbewahrung der Jahres- und Dauerakten nichts; immer noch hatten wir mehrere hundert Bundesordner mit Papier, und Ende Jahr war die ganze Firma damit beschäftigt, die Jahresakten ins Archiv und die nicht mehr benötigten zehnjährigen Akten zur Verbrennungsanlage zu bringen. Generell hat der Papierverbrauch trotz Digitalisierung stark zugenommen. Das papierlose Büro blieb ein unerfülltes Versprechen! Bis 2014.
Digitale Automatisierung der Wirtschaftsprüfung
2014 schafften wir die Revisionssoftware ReviPS an. Das hatte einen grundlegenden Wechsel in der Arbeitsweise zur Folge. Es gab keine Papierakten mehr – sämtliche Jahres- und Dauerakten mussten digitalisiert und im System abgelegt werden. Vorbei waren also die Zeiten, als der Revisor vollgepackt mit Bundesordnern, Taschenrechner, Block und Stift und allenfalls mit Laptop zur alljährlichen Revision kam. Heute erscheint der Revisor mit dem Notebook, mobilem Zweitbildschirm und Kleinscanner.
Wir sind heute schon so weit, dass wir für diverse Prüfungen automatisierte Programme für Stichproben, Auswertungen usw. einsetzen können; oft scheitert dies jedoch am fehlenden direkten Zugriff auf das Kundensystem bzw. an der Bereitstellung der Daten durch den Kunden. Genau diese Programme werden in Zukunft die Wirtschaftsprüfung massiv vereinfachen, da vor allem Transaktionen, Belege, Plausibilität, Kennzahlen usw. viel effizienter und effektiver geprüft werden können.

Vorteile der digitalen Automatisierung
- Automatische, schnellere Verarbeitung
- Weniger unqualifizierte Routinearbeiten
- Jederzeit und von überall her Zugriff auf die Daten
- Reduktion von Ressourcen wie Büros, Archiven, Regalen, Ordnern, Papier usw.
- Flexibilisierung des Arbeitsplatzes (Homeoffice, Coworking, Büro-Sharing, Bürogemeinschaft usw.)
- Mehr Zeit für individuelle Beratung
Herausforderungen der digitalen Automatisierung
- Unterschiedliche Datenformate
- Ineffiziente Prozesse zur Umwandlung von Daten
- Fehlende Prozesse zur Unterstützung neuer Datenanforderungen
- Schwierigkeiten bei der Datenübermittlung
- Mangelnde Reaktionsfähigkeit von Behörden
- Fehlende Gesetzgebung
Es wird trotzdem nicht einfacher
Dies stellt Revisorinnen vor ganz neue Herausforderungen. So müssen diese die einzelnen Systeme der Kunden verstehen und abschätzen können, ob alle gesetzlichen Vorschriften, wie z.B. Aufbewahrungspflicht, eingehalten werden. Im Bereich IKS müssen Freigabeprozesse verstanden werden. Wie stellt das System sicher, dass die definierten Kompetenzen eingehalten werden? Welche automatischen Kontrollen sind im System implementiert? Wurden die korrekten Parameter gemäss internen Richtlinien in den Stammdaten hinterlegt? Wie ist sichergestellt, dass das System nicht umgangen werden kann?
Die digitale Automatisierung hat und wird die Wirtschaftsprüfung in den kommenden Jahren stark verändern. Nach den guten Erfahrungen in den beiden letzten Jahren wird auch in Zukunft die Mehrheit der Prüfungen, wenn nicht sogar die gesamte Revision nicht mehr physisch vor Ort durchgeführt, sondern virtuell aus der Ferne erfolgen können. Auswertungen und Stichproben werden automatisiert und bereits durch das System vorgenommen.
«Gemäss einer Umfrage einer grösseren Treuhandfirma erhalten und verarbeiten mehr als die Hälfte aller KMU ihre Belege zu 60–100% immer noch in Papierform.»
Vom Zahlen- zum IT-Fachwissen
In der Ausbildung von Revisorinnen wird ein starker Fokus auf das Verständnis im Bereich IT-Prozesse und Systemabläufe gelegt werden müssen. Die steigenden Anforderungen an die Wirtschaftsprüfung und die damit verbundenen Kosten führen zu höheren Revisionshonoraren. Wir versuchen, dem mit den nötigen Investitionen und der Implementierung von digital automatisierten Prozessen entgegenzutreten. Das bedingt aber auch, dass unsere KMU-Kunden die digitale Automatisierung in den nächsten Jahren stark vorantreiben. Die COVID-19-Pandemie hatte diesbezüglich bereits einen positiven Einfluss, es braucht aber weiterhin einen grossen Effort aller Beteiligten.
Nicht ganz zu vergessen sind die negativen Einflüsse der digitalen Automatisierung: So nimmt der persönliche Kontakt zum Kunden immer mehr ab. Hier sind die Revisoren und die Kunden gefordert, ein gesundes Mittelmass zu finden.
Für uns als moderne Treuhandfirma ist die digitale Automatisierung der Geschäftsprozesse eine grosse Chance. Unser Ziel ist es, sämtliche administrativen Prozesse zu vereinfachen, Routinearbeiten von intelligenten Systemen erledigen zu lassen sowie den Datenaustausch mit unseren Kunden, Behörden und Dritten zu digitalisieren und zu automatisieren. Die gewonnene Zeit werden wir für die Beratung und Pflege unserer Kunden einsetzen können.
«Die Wirtschaftsprüfung bewegt sich von der Befragung und der Belegprüfung immer mehr hin zu einer komplexen Prüfung von IT-System und deren Funktionen.»
Lesen Sie online mehr zum Thema:
Die automatisierte Steuererklärung
Die digitale Buchhaltung als Wettbewerbsvorteil
Weisst du noch …?
Obwohl die ersten Computer 1941 entstanden, dauerte es 40 Jahre, bis 1981 IBM mit dem PC 1 den ersten Personalcomputer auf den Markt brachte, der einigermassen erschwinglich war, auch für KMU. Bis dahin war in den Büros die Schreibmaschine oder das Schreibsystem der grösste Luxus. Die PCs wurden mehrheitlich als digitale Schreibmaschine eingesetzt, WinWord war das meistgebrauchte Programm. Nur langsam wurde der Nutzen der Tabellenkalkulationsprogramme Multiplan, Notes, Symphony und Excel erkannt. Doch noch heute gibt es viele Anwenderinnen und Anwender, die lieber eine Tabelle in Word statt in Excel erstellen und, ja, Berechnungen mit dem Taschenrechner ausführen!
In eigener digitaler Sache
«Nach einer unfallbedingten Operation an meiner rechten Schulter im Frühling dieses Jahres musste ich sie während drei Monaten auf einem Abduktionskissen ruhigstellen. Die Arbeit mit dem linken Arm gestaltete sich schwierig. Während die Bedienung der Maus durch die Umstellung der Tasten auf links nach kurzer Zeit recht gut ging, war das einhändige Tippen weder effizient noch angenehm und die Shortcuts teilweise unmöglich auszuführen. So probierte ich die Spracherkennung von Microsoft aus. Meine ersten Übungen führten zu einer Erkennungsrate von nur knapp 20 %. Heute erkennt die Software zwischen 95 und 99 % meiner gesprochenen Worte, inklusive Schweizerdeutsch, und wandelt diese in Text um. Der Beitrag in den letzten Business News ist der erste Text, der komplett so entstanden ist. Heute erfasse ich fast alle Word-Texte und E-Mails auf diese Weise. Die Zeitersparnis beträgt ca. 50 %, und das nicht, weil ich ein langsamer Schreiber bin.» Reto Gribi









