Nicht alles geht viral
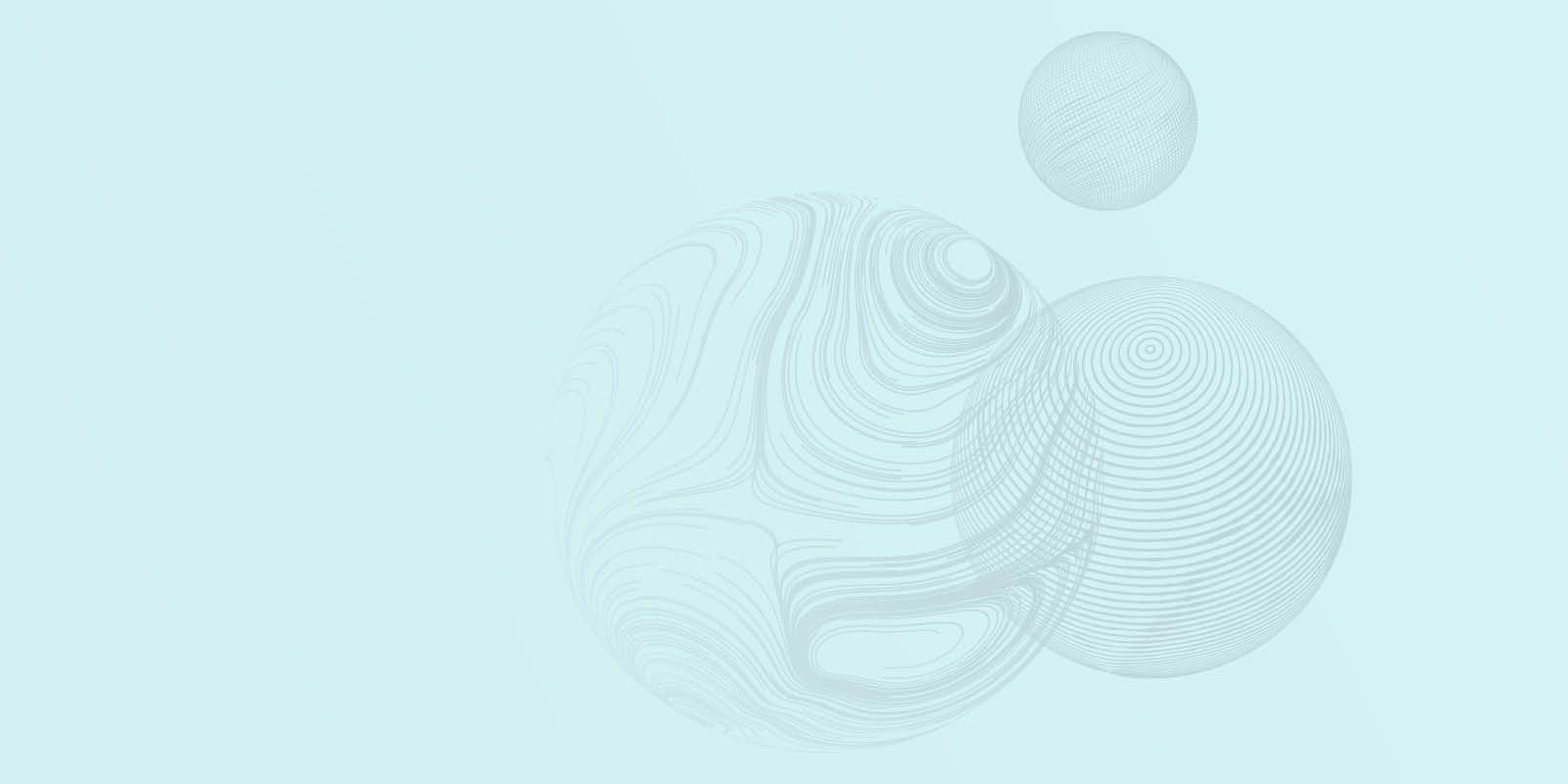
Der Traum vieler Marketingleute: Ihre Botschaft verbreitet sich in Windeseile in den sozialen Medien. Sie geht viral. Doch das funktioniert so gut wie nie: Der Erfolg ist kaum vorhersehbar. Die Erkenntnisse aus der Covid-Pandemie helfen zu verstehen, warum das so ist.
Seitdem sich die Welt mit dem Coronavirus herumschlägt, weiss jeder, was es bedeutet, wenn etwas viral geht: in diesem Fall das Virus SARS-CoV-2. Im Laufe des Frühjahrs haben wir gelernt, dass «R» das Mass aller Dinge ist. Anhand von R, der Reproduktionszahl bzw. der Anzahl neuer Fälle, für die eine infizierte Person verantwortlich ist, lässt sich beurteilen, ob sich das Virus in der Bevölkerung ausbreitet oder nicht. Liegt sie über dem Wert von 1, breitet sich das Virus aus, liegt sie darunter, verschwindet es. Wie gebannt hing die Schweiz an den täglichen Verkündungen des Reproduktionswerts.
R ist jedoch nicht nur bei der Betrachtung von Viruspandemien nützlich, sondern verspricht in vielen Bereichen des Lebens wertvolle Einsichten. Ausgerechnet in diesem Jahr – als hätte er es geplant – hat der britische Mathematiker und Epidemiologe Adam Kucharski sein Buch «Das Gesetz der Ansteckung» veröffentlicht. Nicht nur Viren verbreiten sich gemäss Kucharski rasend schnell, auch technische Neuerungen können sich binnen kürzester Zeit durchsetzen, Ideen verbreiten sich in Windeseile, Gerüchte machen die Runde oder Content in den sozialen Netzwerken geht viral. In allen Fällen spielt der Wert R eine wichtige Rolle und entscheidet darüber, ob etwa ein Posting auf Facebook, ein Tweet oder ein Blogeintrag die Welt des Internets erobert. Wenn jeder Empfänger eines Tweets ihn im Durchschnitt mehr als einmal retweetet (Wert über 1), verbreitet er sich; wenn nicht (unter 1), verschwindet er irgendwann wieder.
Die Chancen sind gleich null
Wie unwahrscheinlich es ist, dass ein Post sich wie von selbst verbreitet, ahnt man, wenn man sich die Masse an Content vor Augen führt, die pro Tag über die Bildschirme flimmert! Wenige der Posts teilt man mit anderen, retweetet sie oder klickt auf die Like- oder Herzchen-Buttons. Man braucht weder Papier und Bleistift noch einen Taschenrechner, um zu merken, dass der R-Wert bei den allermeisten Posts ziemlich nahe bei null liegt. Im Klartext: Sie sind ziemlich erfolglos und gehen im digitalen Schüttgut unter, das sich sekündlich ins Internet ergiesst. Um die Erfolgschancen zu verbessern, schaufeln Algorithmen Posts nach bestimmten Kriterien wieder in die Aufmerksamkeitszone der Nutzerinnen und Nutzer, immer in der Hoffnung, dass die Zeit bis zu ihrem Verschwinden etwas hinausgezögert werden kann. Influencer sollen dem Content und dessen weiteren Verbreitung mehr Beachtung schenken, bis er verschwindet. Influencer, so die Hoffnung der Marketer, sind die Superspreader im Internet.
Kaum Erklärungen für das Warum
Natürlich haben sich viele mit der Frage beschäftigt, welches die Erfolgsfaktoren sind, die zur Verbreitung von Content im Internet führen. Schon vor über zehn Jahren untersuchten Jonah Berger und Katherine Milkman von der University of Pennsylvania, welche Artikel der «New York Times» die grössten Chance hatten, geteilt zu werden. Emotionale Betroffenheit erhöhte diese Wahrscheinlichkeit, egal ob es Begeisterung, Entsetzen oder Ablehnung war. Alles in allem war die Suche nach den Erfolgsfaktoren ernüchternd: Zu über 93 Prozent lässt sich nicht erklären, wieso Content geteilt wird. Planbar ist der Erfolg nicht. «Schnapsideen» ausprobieren und herumspielen scheinen eher zum Ziel zu führen als ausgetüftelte Businesspläne. Das ist die Quintessenz aus dem Erfolg der deutschen Wochenzeitung «Die Zeit». Das Traditionsblatt hat es nämlich geschafft, auf Spotify zum dritterfolgreichsten Publisher in Europa zu werden, nach der BBC und dem schwedischen Radio. Am häufigsten wird der Podcast «Verbrechen» gestreamt. Die Idee dazu entstand beim Mittagessen, wie der Chefredaktor Jochen Wegner der Medienwebsite kress.de berichtet. Die Nummer zwei ist das Interviewformat «Alles gesagt». Eine Folge des Podcasts läuft so lange, bis der Interviewte ein Codewort sagt und damit das Interview beendet. Das längste Interview dauerte zwölf Stunden, das kürzeste 15 Minuten. «Richtig strategisch geplant war das alles nicht», sagt Wegner. Aber enorm erfolgreich.









